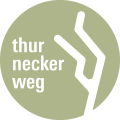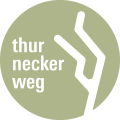
Einzigartige Landschaften zwischen Wasser und Erde
Als sich die Gletscher nach der letzten Eiszeit zurückzogen, blieben zahlreiche Mulden und Senken voller Schmelzwasser zurück. Mit der Erwärmung des Klimas besiedelten Pflanzen diese Tümpel, wuchsen ins Wasser hinein und starben dort ab. Weil das nasse, sauerstoffarme Milieu ihre Zersetzung verlangsamte, sammelten sich über Jahrtausende Schicht um Schicht Pflanzenreste. Torf entstand – und mit ihm eine Landschaft, die selten und empfindlich ist: das Moor.
In der Schweiz und auch im Toggenburg finden sich zwei Typen: Hochmoore und Flachmoore.
Hochmoore leben ausschliesslich von Niederschlag. Ohne unterirdischen Wasserzufluss sind sie extrem nährstoffarm. Sie wirken karg, doch gerade diese Reduktion macht sie zu besonderen Lebensräumen. Hier gedeihen Spezialisten wie Moorlibellen oder der Sonnentau, eine Pflanze, die Insekten fängt, um ihren Nährstoffbedarf zu decken. Torfmoose sind die eigentlichen Baumeister der Hochmoore: Während sie oben weiterwachsen, sterben sie unten ab und bilden stetig neues Torfmaterial. Über Jahrhunderte wächst so ein Hochmoor Millimeter für Millimeter in die Höhe. Ein Prozess von kaum vorstellbarer Langsamkeit, der seine besondere Schutzwürdigkeit unterstreicht.
Flachmoore dagegen stehen in Verbindung mit Grund- oder Quellwasser. Sie sind nährstoffreicher und dadurch artenreich. Hier blüht eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen, Insekten und Amphibien. Viele dieser Arten sind heute selten geworden und finden im Moor einen der letzten Rückzugsorte.
Doch Moore sind weit mehr als Rückzugsräume für besondere Arten. Sie sind Speicher und Filter zugleich: Sie binden grosse Mengen an Kohlenstoff und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum natürlichen Gleichgewicht unserer Landschaften. Wie Schwämme nehmen sie Wasser auf, halten es zurück und geben es langsam wieder ab. Ein natürlicher Schutz vor Überschwemmungen wie auch vor Trockenheit.
Doch diese wertvollen Ökosysteme sind bedroht. Über Jahrhunderte wurden Moore entwässert, als Weideland genutzt oder für den Torfabbau ausgebeutet. Was in Jahrtausenden gewachsen ist, kann in wenigen Jahrzehnten zerstört werden. Heute stehen Moore unter strengem Schutz – die wertvollsten sind in nationalen Inventaren erfasst, viele werden durch Renaturierungen wiederbelebt. Ihr Erhalt ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine kulturelle Aufgabe: eine Verantwortung gegenüber den stillen Erben der Eiszeit.
Moorgebiete
Das Toggenburg ist Heimat zahlreicher Moorgebiete. Sie zählen zu den wertvollsten Ökosystemen der Region und sind von nationaler Bedeutung. Ihre Entstehung reicht bis in die Zeit nach der letzten Eiszeit zurück. Gletscher hinterliessen Mulden, die sich mit Wasser füllten und über Jahrtausende zu Mooren entwickelten.
Torfmoose, das Herzstück dieser Lebensräume, wachsen nur langsam und speichern grosse Mengen Kohlendioxid – insbesondere in Hochmooren, wo sie mit der Zeit mächtige Torfschichten aufbauen. Moorgebiete wie das Hochmoor auf der Wolzenalp oder das Flachmoor rund um den Gräppelensee sind nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch von unschätzbarem Wert für die Biodiversität.
Moore bedecken etwa 3 % der Landfläche, speichern aber rund 30 % des irdischen Kohlenstoffs – doppelt so viel wie die gesamte Waldfläche der Erde. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber menschlichen Eingriffen und Klimaveränderungen sind sie streng geschützt.