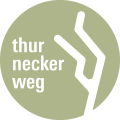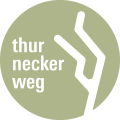
Das Toggenburg klingt
Klang hat im Toggenburg eine besondere Bedeutung. Er ist nicht nur Ausdruck von Festen und Ritualen, sondern Teil des Alltags und eng mit Geschichte, Landschaft und Lebensweise verbunden. Wer durch die Täler wandert, begegnet ihm auf vielfältige Weise.
Neben den Stimmen, die im Jodel ihren Ausdruck finden, sind es Instrumente, die den Klangraum erweitern. Das Hackbrett mit seinem trapezförmigen Resonanzkörper verbindet seit Jahrhunderten Melodie und Rhythmus in den Stuben der Region. Die Toggenburger Halszither, kompakt und mit dreizehn Saiten gebaut, diente als unkompliziertes Begleitinstrument im häuslichen Musizieren. Im 18. und 19. Jahrhundert kamen in vielen Bauernhäusern kleine, reich verzierte Hausorgeln hinzu; sie wurden im Alltag gespielt und gaben Andachten einen festen Klang. Das Alphorn, ursprünglich ein Ruf- und Signalinstrument, blieb als Naturtonträger erhalten und wurde ebenso für musikalische Stücke genutzt.
Was heute als kulturelles Erbe erscheint, hatte seinen Ursprung oft in schlichten Funktionen. Alphörner dienten über Jahrhunderte als Kommunikationsmittel in den Bergen, ihre Schallwellen trugen Botschaften über Täler hinweg. Glocken strukturierten das Dorfleben, gaben Arbeits- und Gebetszeiten vor und begleiteten Übergänge im Jahreslauf. Senntumschellen wiederum hatten die Aufgabe, Herden hörbar zu machen, bevor sie zu Symbolen bäuerlichen Stolzes wurden. Aus diesen praktischen Wurzeln entwickelte sich eine reiche Klangkultur, die noch heute hörbar ist. Der Jodel zählt zu ihren sichtbarsten Formen. Bereits im 16. Jahrhundert finden sich schriftliche Hinweise auf mehrstimmiges Jodeln in den Alpen. Im Toggenburg überlebte er sowohl als Naturjodel ohne Worte, der spontan gesungen wird, als auch in organisierter Form in Jodelchören. Diese Vereine pflegen ein Repertoire, das von einfachen Rufmotiven bis zu kunstvoll gesetzten Stimmen reicht. Auch Talerschwingen oder Schelleschötte haben sich erhalten – Praktiken, die auf den ersten Blick verspielt wirken, aber feste Regeln und ein geschultes Gehör erfordern. Sie zeigen, wie Klang auch im privaten Rahmen Teil von Geselligkeit und Identität war.
Beim Schelleschötte entsteht Rhythmus aus wenigen Mitteln. Drei aufeinander abgestimmte Kuhschellen bilden ein Gspil; die Spielerinnen und Spieler schlagen festgelegte Muster, variieren Akzente und finden im Zusammenspiel einen gemeinsamen Puls, der sich gut mit Jodelmelodien verbinden lässt. Das Talerschwingen nutzt heute meist ein grosses Keramikbecken als Resonanzkörper, früher war es oft ein einfaches Milchbecken. Eine Münze wird an der Innenwand in kreisende Bewegung versetzt, bis ein gleichmässiger, obertonreicher Ton entsteht. Beide Formen zeigen, wie Alltagsgegenstände zu eigenständigen Klangkörpern werden und wie präzise Hören und Timing in diesen Traditionen verankert sind.
Dass Klang im Toggenburg nicht Vergangenheit ist, sondern Gegenwart und Zukunft, zeigt sich in der Klangwelt Toggenburg. Mit Klangweg, Klangschmiede, Resonanzzentrum und Klanghaus hat die Region Orte geschaffen, an denen Wissen, Praxis und Forschung zusammenfinden. Hier begegnen sich überlieferte Traditionen, pädagogische Arbeit und zeitgenössische Experimente. So bleibt Klang nicht nur hörbar, sondern erfahrbar – eingebettet in eine Landschaft, die selbst Resonanzraum ist und als Resonanzkörper wirkt.
Stimmen und Instrumente
Noch heute steigen Toggenburger Älpler und Älplerinnen abends auf eine Anhöhe, richten den Blick gen Himmel und lassen ihre Stimme über der Landschaft ertönen. In archaischem Sprechgesang segnen sie Mensch, Vieh und Landschaft, danken für den Tag und bitten um Schutz vor Gefahren. Der Ausdruck einer tiefen Verbundenheit. Über Generationen weitergegeben, unterscheidet sich der Betruf von Alp zu Alp – einzigartig, doch oft beginnend mit «Ave Maria». Gerufen wird laut und kräftig, gesprochen wird, was im Herzen liegt. Der Klang trägt weit, bis in die Täler, verstärkt durch einen hölzernen Trichter, der wie ein Megaphon geformt ist. Angelehnt an diese Form ist auch der Klangbotschafter, der Sie an diesem Ort klangvoll empfängt.
Noch tiefer in die Welt der Klänge eintauchen? Von der Alp Sellamatt über Iltios bis ins Oberdorf lassen mehr als zwei Dutzend Skulpturen die Natur in Tönen schwingen. Der Klangweg macht neugierig, lädt ein zum Ausprobieren und öffnet das Ohr für bisher Ungehörtes.
Im Toggenburg hat die Stimme ihren festen Platz. Jodelchöre prägen das kulturelle Leben in vielen Gemeinden. Das gemeinsame Singen: fest verankertes Brauchtum. Rund ums Jahr lässt sich an Konzerten und Jodlerabenden den traditionellen Chören lauschen, die mit Silbenjodel und Strophentexten die ganze Klangfülle dieser Tradition hörbar machen. Der Naturjodel folgt da anderen Regeln. Beim Johle gibt es keinen Text. In diesem wortlosen Gesang führt allein die Stimme. Gejohlt wird auf dem Weg zur Alp, beim Abwasch in der Hütte oder draussen in der Natur.
Begleitet werden die Stimmen oft vom Schelleschötte oder Talerschwingen. Drei klanglich aufeinander abgestimmte Kuhschellen oder Tonschüsseln bilden jeweils ein Gspil. Beim Schötte werden die Schellen rhythmisch angeschlagen – beim Talerschwingen lässt ein silberner Fünfliber die Talerbecken erklingen. Die Münze kreisen oder die Schelle klingen lassen – das geht in der Klangschmiede. Die eigene Stimme entdecken Sie in den Kursen der Klangwelt Toggenburg.
Ursprünglich aus dem Orient stammend, blieb das Hackbrett im Toggenburg fest verwurzelt. Charakteristisch ist der trapezförmige Resonanzkörper, dessen Saiten durch Stege in Segmente aufgeteilt sind – so entstehen unterschiedliche Töne. Im 18. und 19. Jahrhundert fand die Toggenburger Hausorgel ihren Platz in manchen Bauernhäusern. Reich verziert mit Ornamenten und Rocaillen, aufgebaut in der Firstkammer. Meist von Frauen gespielt, diente sie nicht nur der musikalischen Untermalung von Andachten, sondern galt auch als Ausdruck eines gewissen Wohlstands in bäuerlichen Kreisen. Ganz anders die Toggenburger Halszither – einfach und kompakt gebaut, war sie mit ihren 13 Saiten ein praktisches Begleitinstrument für den Hausgebrauch. Das Alphorn – ein Naturinstrument ohne Ventile – hat auch im Toggenburg Tradition. Sein Klang trägt weit, einst diente es der Verständigung über grosse Distanzen.
Zeugnisse dieser Klangkultur finden sich im Ackerhus und im Toggenburger Museum. Lebendig wird sie bei Proben, Konzerten und musikalischen Begegnungen im Klanghaus Toggenburg.