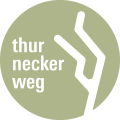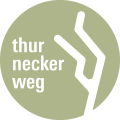
Innovation und Unternehmergeist
Bereits im 17. Jahrhundert war das Toggenburg Teil eines europaweiten Netzwerks der Textilverarbeitung. In den Bauernhäusern wurde Garn gesponnen, gewebt oder bestickt – meist als Nebenerwerb zur Landwirtschaft. Die Arbeit war im sogenannten Ferggersystem organisiert: Händler, die Fergger, brachten Rohmaterialien wie Baumwolle, Flachs oder Seide in die Häuser und liessen die fertigen Stoffe oder Stickereien später wieder abholen. Auf diese Weise gelangten Textilien aus dem Toggenburg über Handelsplätze wie St. Gallen und Zürich auf Märkte in ganz Europa.
Im 18. und frühen 19. Jahrhundert erlebte die Region einen Aufschwung. Besonders die feinen Mousseline-Stoffe, die hier hergestellt wurden, waren international gefragt. Frauen und Mädchen arbeiteten oft stundenlang am Spinnrad oder Stickrahmen, während Männer zusätzlich im Ackerbau tätig waren. Die Heimarbeit brachte Geld ins Tal, führte aber auch zu Abhängigkeiten von den Ferggern, die die Preise diktierten.
Mit der Industrialisierung veränderte sich die Struktur grundlegend. Mechanische Spinnereien und Webereien entstanden entlang der Thur und ihrer Zuflüsse, wo Wasserkraft die Maschinen antrieb. Fabriken wie in Dietfurt oder Wattwil beschäftigten im 19. und 20. Jahrhundert mehrere hundert Menschen. Die Arbeit verlagerte sich aus den Stuben in die Fabrikhallen, mit festen Arbeitszeiten, Schichtbetrieb und neuen sozialen Regeln. Gleichzeitig öffnete sich der Markt weiter: Toggenburger Stoffe und Stickereien wurden nach Übersee exportiert, insbesondere nach Nordamerika.
Im 20. Jahrhundert kam es zu Brüchen. Die Weltwirtschaftskrise, Billigimporte und veränderte Mode führten zu einem Niedergang der Textilindustrie. Zahlreiche Betriebe mussten ihre Tore schliessen, ganze Belegschaften verloren ihre Arbeit. Dennoch gingen wichtige Innovationen aus dieser Tradition hervor, etwa die Entwicklung neuer Kunstfasern oder die Weiterführung einzelner Produkte, die auch heute noch hergestellt werden. Dazu zählt das Toggenburger Tüechli, das auf eine lange Tradition zurückgeht und bis heute in Bütschwil produziert wird.
Während die Textilindustrie zurückging, entstanden neue Industriezweige. Aus einer Region, die lange für Stoffe und Stickereien bekannt war, wurde ein Standort für ganz unterschiedliche Branchen: Sportgeräte, Bürsten, Bio-Lebensmittel, Maschinenbau und Spezialtechnologien. Auch in der Finanzgeschichte hinterliess das Tal eine Spur: 1862 wurde in Lichtensteig die Bank gegründet, aus der die heutige UBS hervorging. Diese Entwicklung zeigt, wie flexibel sich das Tal den Veränderungen der Zeit anpasste. Industrie im Toggenburg steht damit für Erfindungskraft und Unternehmergeist in ganz verschiedenen Formen – von der Heimarbeit vergangener Jahrhunderte bis zu Strukturen, die weit über das Tal hinaus wirken.
Industrie früher und heute
Die Region überrascht nicht nur mit Natur und Ruhe, sondern auch mit Unternehmergeist, Cleverness und internationaler Präsenz. Hier wird erfunden, entwickelt und exportiert. Was in Werkhallen entlang von Thur und Necker entsteht, findet seinen Weg in die ganze Welt.
Seit Generationen turnen Kinder und Erwachsene weltweit auf Geräten aus dem Toggenburg und Bürsten von hier sind täglich in unzähligen Haushalten und Industriebetrieben im Einsatz. Seit Jahrzehnten werden Anti-Dopingkontrollen an Olympischen Spielen mit Lösungen aus dem Toggenburg durchgeführt und Sensoren von hier sind gar in der Raumfahrt anzutreffen. Und das ist längst nicht alles: Auch vegane Bioprodukte aus dem Toggenburg haben ihren Platz im internationalen Handel, technische Lösungen aus beiden Tälern sind global gefragt. Maschinen, die nicht von der Stange kommen, werden hier konstruiert. Und ja – auch die UBS, eine der grössten Banken weltweit, hat ihre Wurzeln an der Thur: gegründet 1863 in Lichtensteig.
Im 17. und 18. Jahrhundert spielte die Textilindustrie eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Toggenburgs. In Heimarbeit wurde gesponnen, gewebt und gestickt – meist als Nebenerwerb zur Landwirtschaft, vermittelt durch sogenannte Fergger. Besonders gefragt waren feine Mousseline-Stoffe aus Baumwolle. Die Toggenburger Tücher wurden in ganz Europa geschätzt und bis nach Asien, Afrika und Südamerika exportiert. Im 19. Jahrhundert erlebte die Stickerei einen markanten Aufschwung. Hunderte Handstickmaschinen wurden zuhause aufgestellt. In der Modeindustrie gefragt, gelangten Toggenburger Stickereien bis nach Nordamerika.
In Stuben, Kellern und Sticklokalen wuchs ein Erfahrungsschatz, der zur Grundlage für den industriellen Erfolg wurde: Die Spinnerei und Weberei Dietfurt AG entwickelte sich zu einem der grössten Arbeitgeber im Tal. Die Heberlein AG in Wattwil schrieb mit der Entwicklung der elastischen Helanca-Faser Textilgeschichte. Und in Bütschwil lebt das Toggenburger Tüechli von Meyer-Mayor bis heute weiter.