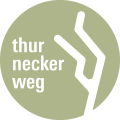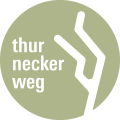
Lebendige Handarbeit
Handwerk im Toggenburg zeigt sich in vielen Formen. Es ist sichtbar in den Häusern, hörbar im Klang der Schellen und bewahrt in kunstvoll bemalten Möbeln. Vieles von dem, was einst für das tägliche Leben unabdingbar war, hat sich bis heute erhalten und auch das Wissen darum wird weitergegeben.
Die Senntumschellen gehören untrennbar zur Alp- und Viehkultur. Ihr Ton kündigt an, dass die Herde unterwegs ist, begleitet den festlichen Alpaufzug und trägt weit über die Hänge hinaus. Hier eine kleine Anmerkung, um Missverständnissen vorzubeugen: Im Toggenburg sind es keine Kuhglocken, denn Glocken tragen hier meist die Geissen. Beide – nicht die Tiere, sondern die Klangelemente – sind das Ergebnis präziser Handarbeit. Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Glocken werden traditionell aus Bronze gegossen, Schellen dagegen entstehen im Schmiedefeuer aus Eisenblech. Sie werden erhitzt, gehämmert und geformt, bis Gewicht und Ton in Einklang sind. Schon kleine Unterschiede in Material und Bearbeitung verändern den Klang – Erfahrung und Gehör des Schmieds sind daher entscheidend. Getragen werden die Schellen an Lederriemen – handgefertigt in der Sattlerei –, die mit Ornamenten, Stickereien und Metallbeschlägen von Ziselierern und Posamentern geschmückt sind. So entstehen Gesamtkunstwerke, die zugleich Ausdruck einer langen Tradition und eines Stücks Identität verkörpern.
Ein weiteres, einst unverzichtbares Handwerk, war die Weissküferei. Küfer stellten Gefässe aus Holz her – Chübel, Bottiche und Eimer, die vor allem in der Milchwirtschaft in Gebrauch waren und auf der Alp bis heute noch sind. Ihre Besonderheit lag darin, dass sie ohne Leim gefertigt wurden und dennoch absolut dicht hielten. Eine Kunst, die viel Erfahrung und Gespür für das Holz, seine Fasern und sein Verhalten im Gebrauch bedingte. Mit dem Aufkommen moderner Materialien verlor dieses Handwerk seine Bedeutung, doch im Toggenburg gibt es eine Werkstatt, in der es weitergeführt wird. In Ennetbühl besteht bis heute eine Weissküferei, die dieses Wissen bewahrt und so ein fast ausgestorbenes Gewerbe am Leben erhält.
Auch die Bauweise der Häuser trägt die Handschrift regionalen Könnens. Die sogenannten Tätsch-Häuser entstanden in Strickbauweise und sind mit ihren charakteristischen Schindelfassaden bis heute ein vertrauter Anblick. Schindeln werden traditionell nicht gesägt, sondern von Hand gespalten. Ein entscheidender Unterschied, denn nur so folgt das Holz seinem natürlichen Faserverlauf und bleibt widerstandsfähig gegen Regen, Schnee und Frost. Fichte und Lärche waren die bevorzugten Hölzer: Lärche wegen ihrer Harzanteile besonders langlebig, Fichte leicht verfügbar. Schicht für Schicht wurden die Schindeln so dicht übereinandergelegt, dass sie Wind und Wetter jahrzehntelang standhielten. Noch heute greifen Restaurierungen auf dieses Wissen zurück und auch mancher Neubau kleidet sich gern in traditionellen Holzschindeln.
Neben Holz und Metall fand auch die Farbe ihren Platz im Toggenburger Handwerk. Aus der Möbelmalerei entwickelte sich im 19. Jahrhundert die Senntumsmalerei, die Szenen aus dem bäuerlichen Leben aufnahm und zu einer eigenen Kunstform wurde. Beliebt waren Sennenstreifen mit Alpaufzügen, bemalte Melkeimerbödeli oder Tafelbilder, die das Leben auf den Alpen festhielten. Künstler wie Gottlieb Feurer, Felix A. Brander und Niklaus Wenk prägten die Tradition. Besonders bekannt wurde Anna-Barbara Aemisegger-Giezendanner – oft «Babeli» genannt –, eine der wenigen Frauen in diesem Metier. Sie hielt das einfache Leben der Menschen mit unverkennbarer Handschrift fest und schuf Werke, die noch heute in Museen und Privatsammlungen erhalten sind. Im Unterschied zur Appenzeller Bauernmalerei, die oft stilisiert und ornamental wirkt, sind die Toggenburger Arbeiten erzählerischer und nah am Alltag. Sie dokumentieren, was die Menschen umgab, und verwandeln es in anschaubare Erinnerung.
So zeigt sich das Handwerk im Toggenburgs als lebendige Kultur – hörbar auf den Alpen, sichtbar in den Häusern und gegenwärtig in vielen Werkstätten.
Kultur und Brauchtum
Man hört sie, oft lange bevor man ihren Träger entdeckt. Die Schelle, klar im Ton und weit im Klang. Senntumschellen gehören zur Alp- und Viehkultur der Region. Sie haben nicht nur symbolischen Wert, sondern dienen auch praktischen Zwecken. Für ihren Klang braucht es mehr als Eisen und Feuer. Jede Schelle wird klanglich abgestimmt – mit präzisen Hammerschlägen und einem gut geschulten Gehör.
In der sennischen Kultur sind sie auch heute noch gefragt: Fahreimer, Buder (Butterfass) und vieles mehr, gefertigt aus feinstem Ahorn- und Fichtenholz, in traditioneller Handarbeit vom Weissküfer. Dieses seltene Handwerk wird in Ennetbühl bis heute gepflegt – in einer der letzten Weissküfereien der Schweiz.
Mit Hammer und Punzen treibt der Ziselierer Muster ins Metallblech, meist aus Messing oder Silber. Jedes einzelne Stück erkennt er wieder. Sein feines Werkzeug fertigt er oft gleich selbst an. Meist finden die Beschläge ihren Platz in der Sennensattlerei: auf Riemen, Gürteln und Hosenträgern, kombiniert mit besticktem Leder und Posamenten.
Die sogenannten Tätsch-Häuser entstanden in Strickbauweise. Diese Technik war stabil, einfach umzusetzen und passte zur guten Verfügbarkeit des Holzes. Zum Schutz vor Wind, Regen und Schnee wurden Fassaden und Dächer mit Schindeln aus heimischer Fichte oder Lärche gedeckt. Das Schindeln erfordert Erfahrung und Geschick – jede einzelne wird sorgfältig von Hand gespalten und präzise geschichtet.
Möbel aus regionalem Holz wurden häufig bemalt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Senntumsmalerei als eigene Ausdrucksform. Noch immer populär: der berühmte Sennenstreifen. Bemalte Melkeimerbödeli gehören ebenfalls zur lebendigen Senntumstradition. Mit dem Rückgang der Möbelmalerei setzten sich Tafelbilder als Wandschmuck durch. Prägende Künstler:innen sind Gottlieb Feurer, Felix A. Brander, Niklaus Wenk und Anna-Barbara Aemisegger-Giezendanner.
Natürlich sind auch die Elemente entlang des Thur- und Neckerwegs «aus heimischem Holz». Von hier und vor Ort verarbeitet.