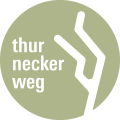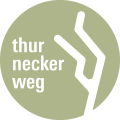
Zeugen der Vergangenheit
Der Name Churfirsten gibt bis heute Rätsel auf und wird in der Forschung auf verschiedene Weise erklärt, wobei nicht alle Theorien gleich belegt sind. Sicher ist, dass der zweite Bestandteil, First, im alemannischen Sprachraum für einen Dach- oder Gebirgskamm steht und die markante Form der Gipfel treffend beschreibt. Weniger eindeutig ist die Bedeutung von Chur. Sprachwissenschaftler sehen darin entweder einen Bezug zum Bistum Chur oder zu einem alten Flurnamen, ein gesicherter Nachweis fehlt jedoch. Eine volkstümliche Deutung verbindet die sieben markanten Gipfel der Churfirsten mit den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs. Diese Deutung stammt vermutlich nicht aus der Zeit, als der Name entstanden ist, sondern entwickelte sich erst später im Sprachgebrauch. Frühere Schreibweisen wie Churfürsten oder Churfürschte belegen, dass sich die Lautung laufend verändert hat, bis sich die heutige Form Churfirsten durchsetzte. Der Name selbst ist damit Teil der Kulturgeschichte und nicht nur eine geografische Bezeichnung.
Nicht weniger charakteristisch für das Toggenburg sind die verstreuten Einzelhöfe, die das Tal bis heute prägen. Statt dichter Dorfkerne entwickelte sich eine Siedlungsform, bei der Häuser und Ställe weit über Wiesen, Hänge und Geländekuppen verteilt liegen. Die Gründe dafür waren praktisch: Bauern bauten dort, wo Wasser zugänglich war, Weiden nahe lagen und sich der Alltag mit Viehhaltung und Feldarbeit effizient organisieren liess. Über Jahrhunderte entstand so eine offene Kulturlandschaft, die weder geplant noch zufällig ist, sondern eine direkte Folge der topographischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Heute gilt diese Streusiedlungsweise als Kulturerbe von nationaler Bedeutung.
Vom 13. bis ins 15. Jahrhundert bestimmten die Grafen von Toggenburg die Geschichte der Region. Ihr Stammsitz war die Burg Alt-Toggenburg auf dem Iddaberg bei Kirchberg, später residierten sie auf der Burg Neu-Toggenburg oberhalb von Oberhelfenschwil. Das Geschlecht verfügte über weitreichenden Besitz, der bis ins Rheintal und nach Graubünden reichte und gehörte zu einer der einflussreichsten Familien im Spannungsfeld zwischen Habsburg, Zürich und dem Kloster St. Gallen. Mit dem Tod von Friedrich VII. im Jahr 1436 erlosch die Linie. Sein kinderloses Ableben führte zu einem Erbstreit, in den Zürich, die Habsburger und weitere eidgenössische Orte verwickelt waren. Daraus entwickelte sich der Alte Zürichkrieg (1440 - 1446), einer der grossen Konflikte des Spätmittelalters in der Eidgenossenschaft. Zürich verbündete sich mit Habsburg gegen die übrigen eidgenössischen Orte, erlitt mehrere Niederlagen und musste im Frieden von Einsiedeln seine Ansprüche aufgeben. Für das Toggenburg bedeutete diese Auseinandersetzung jahrelange Unsicherheit und wechselnde Herrschaftsansprüche.
Mit den Grafen ist auch die Verehrung der Heiligen Idda verbunden. Ihre Biografie ist historisch nicht gesichert; die frühesten Quellen stammen aus dem späten 15. Jahrhundert. Überliefert ist die Legende einer adligen Frau, die zu Unrecht verbannt wurde und anschliessend als Einsiedlerin lebte. Die Wallfahrtsstätte St. Iddaburg auf dem Areal der ehemaligen Stammburg hält diese Tradition bis heute lebendig und zeigt, wie sich historische Ereignisse und religiöse Überlieferungen miteinander verbinden und Teil der Erinnerungskultur einer ganzen Region werden können.
Geschichte zeigt sich nicht nur in Herrschaft und Konflikten, sondern auch in den Flurnamen, die die Landschaft durchziehen. Viele von ihnen gehen auf das Althochdeutsche zurück und beschreiben die Nutzung oder Lage des Landes: Matt für eine Wiese, Boden für eine ebene Fläche, Egg für einen Grat oder Rain für eine Geländekante. Andere Namen haben ihren Ursprung im Rätoromanischen, das bis ins Spätmittelalter im Toggenburg präsent war. So weist Sellamatt mit dem Bestandteil -matt klar auf eine Weide hin, während Sella- als „Sattel“ gedeutet wird – eine Bezeichnung für Mulden oder Geländeeinschnitte. Der Name Iltios dürfte dagegen auf den Iltis zurückgehen, der sowohl im althochdeutschen wie im romanischen Sprachgebrauch vorkommt. Solche Flurnamen sind unmittelbare Zeugnisse dafür, wie Menschen ihre Umgebung wahrnahmen, nutzten und in Sprache fassten.
Berge, Siedlungsformen, Adelsgeschlechter und Ortsnamen – sie alle tragen Spuren der Vergangenheit. Im Toggenburg sind sie nicht im Verborgenen, sondern prägen Landschaft und Kultur bis heute.
Toggenburger Geschichte(n)
Chäserrugg, Hinderrugg, Schibenstoll, Zuestoll, Brisi, Frümsel und Selun – sieben Gipfel, deren Name ebenso ausdrucksstark wie geheimnisvoll ist. Woher der Name der markanten Bergkette stammt, ist jedoch nicht abschliessend geklärt – zwei Theorien stehen im Raum.
Die sprachwissenschaftlich bevorzugte Deutung sieht im Namen eine Verbindung aus den Worten «Chur» und «First». «Chur» muss dabei nicht zwingend auf das gleichnamige Bistum verweisen – möglich ist auch der Bezug zu einem alten Flurnamen. «First» steht für einen Dach- oder Gebirgskamm und beschreibt die Form der sieben Gipfel treffend. Eine zweite, volkstümlichere Erklärung führt den Namen auf die sieben Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs zurück. Sie sollen symbolisch in den sieben Hauptgipfeln gesehen worden sein.
Wer hier aufgewachsen ist, weiss es anders: Einst bezwang der Säntisriese einen Drachen, der das Thurtal bedrohte. Seine sieben versteinerten Zacken ruhen noch heute über dem Toggenburg.
Häuser, Höfe und Ställe stehen im Toggenburg oft da, wo man sie nicht erwartet. Eine alte Sage weiss, wie es dazu kam:
Einst lebte ein einsamer Riese im Alpstein, dort, wo sich der Säntis erhebt. Um das Toggenburg mit Leben zu füllen, bat er die Zwerge im Montafon, ihm kleine Häuser zu bauen. In einem riesigen Sack trug er sie über die Berge. Auf Höhe von Wildhaus streifte der Sack den Wildhuser Schofberg und riss auf. Alle Häuser fielen heraus und verteilten sich über das Tal. Zunächst war der Riese ganz erschrocken, doch dann erkannte er, wie schön sich die Häuschen in die Landschaft gebettet hatten. Glücklich lehnte er sich an den Säntis und wurde nicht müde, das emsige Treiben in seinem Tal zu beobachten.
Natürlich hat die Streusiedlung ganz reale Ursachen. Diese Siedlungsform entwickelte sich über Jahrhunderte aufgrund der topografischen Gegebenheiten, der landwirtschaftlichen Nutzung und der Notwendigkeit, nahe bei Stall, Wiese und Wasser zu wohnen.
Das Toggenburg verdankt seinen Namen einem einflussreichen Adelsgeschlecht: den Grafen von Toggenburg, die vom 13. bis ins 15. Jahrhundert über weite Teile der Ostschweiz herrschten. Ihre Stammburg – die Burg Alt-Toggenburg – stand auf der heutigen Iddaburg bei Gähwil. Später residierten sie auf der Burg Neu-Toggenburg oberhalb der Wasserfluh.
Der letzte Graf, Friedrich VII., starb 1436 kinderlos. Sein Tod löste einen Erbstreit aus – und schliesslich den Alten Zürichkrieg. Damit endete die Herrschaft der Toggenburger Grafen.
Aus jener Zeit stammt auch die Legende der Heiligen Idda von Toggenburg. Der Überlieferung nach war sie die Gemahlin eines Grafen, der sie fälschlich der Untreue beschuldigte und aus dem Fenster der Burg stiess. Idda entging dem Tod auf wundersame Weise und lebte fortan als Einsiedlerin beim Kloster Fischingen. Die Wallfahrtsstätte St. Iddaburg auf dem ehemaligen Burgareal erinnert bis heute an sie.